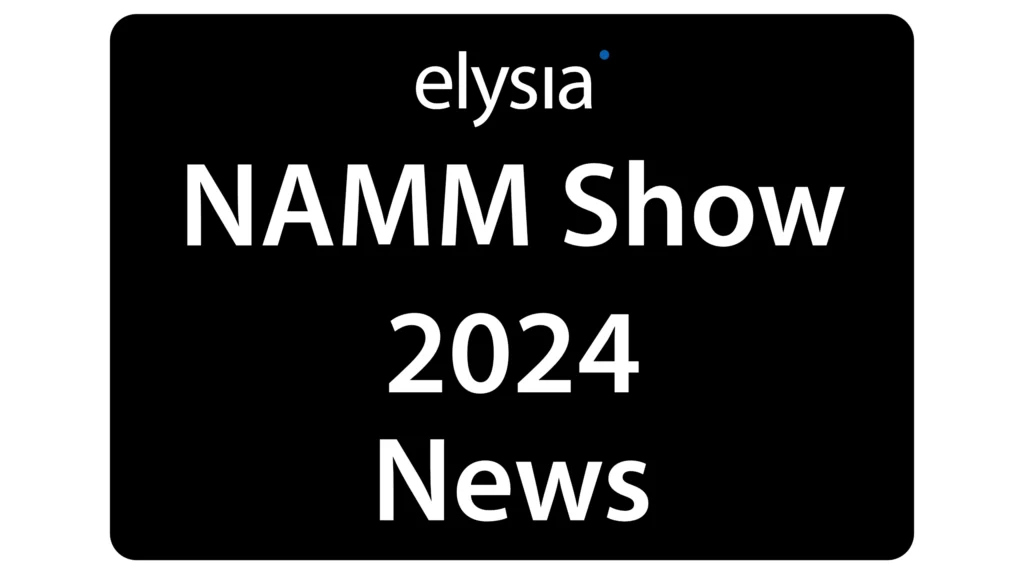Lesezeit: 15 Minuten
Dieser Blogbeitrag startet mit vermeintlich einfachen Fragen: Hatten wir in den letzten Jahrzehnten hochwertigere Musik im Vergleich zum heutigen Standard? Was macht qualitativ hochwertige Musik überhaupt aus? Fakt ist, der Qualitätsbegriff lässt sich von vielen Seiten aus betrachten. Qualität ist auch ein Versuch der Kategorisierung, der sich auf zahlreiche Aspekte von Musik und deren Entstehung übertragen lässt und sich nicht auf Duo „Hardware & Handwerk“ beschränkt. Dieser Blog-Beitrag möchte einen Blick auf den Qualitätsbegriff in Punkto Tontechnik, Komposition und Musikproduktion werfen und sich der Frage stellen, was zeichnet qualitativ hochwertige Musik aus und wie lässt sie sich produzieren?
Was ist Qualität?
Der Begriff „Qualität“ lässt sich auf viele Aspekte im Leben anwenden. Für die Einordnung der Qualität ziehen wir gerne passende Adjektive wie „gut, schlecht oder mittelmäßig“ heran. Während die Beurteilung von Produkten mit Hilfe von Normen (z.B. DIN-Norm) in weiten Teilen nachvollziehbar und damit vergleichbar ist, so transzendent wird der Qualitätsbegriff, wenn man subjektive Zustände wie „Schönheit“ damit evaluieren möchte. Willkommen in dem Dilemma, die Qualität von Musik evaluieren zu wollen. Wir werden es trotzdem versuchen.
Nähern wir uns dem Thema von der Hardware-Seite. Wer kennt nicht die geläufige Meinung, dass Geräte aus vergangenen Jahrzehnten durchweg einen höheren Qualitätsstandard erfüllen. So erscheint die generelle Qualität von Produkten aus den 80er Jahren höher zu sein als ihre heutigen Gegenstücke. Ohne pauschalisieren zu wollen, viele Gerätschaften aus vergangenen Jahrzehnten profitierten durch ihre vergleichsweise lange Entwicklungszeit, aufwändige Bauteile und deren sorgfältige Selektion. Damals galt eine möglichst lange Lebensdauer als ein Kernpunkt der Produktentwicklung.
Und heute?
Die schiere Menge kurzlebiger, günstiger Produkte stand dem Verbraucher vor einigen Jahrzehnten jedenfalls in dieser Breite jedenfalls nicht zur Verfügung.
Nachdem in den letzten Jahrzehnten immer schneller und damit zum Teil auch schlechter produziert wird, stellt sich langsam ein Umdenken ein. Minderwertige Produkte in großen Stückzahlen sind weder Ressourcen schonend noch besonders nachhaltig. Einfache Plastikprodukte finden nur kurze Zeit eine Verwendung bevor sie lange Jahre in unseren Ozeanen als Plastikmüll auf ihre Transformation zu Mikroplastik verbringen. Der Ruf nach neuen Qualitätsstandard und Nachhaltigkeit ist nicht mehr zu überhören. Wir sind der Meinung, dass sollte auch für Musik und Musik Produktion gelten.
Jeder von uns kennt „Qualitätsmusik“ und es braucht keiner DIN-Norm, um sie zu erkennen. Musikalische Qualitätswerke sind mit dem Stempel der „Zeitlosigkeit“ versehen. Aufwendig produzierte und anspruchsvoll komponierte Musik hat einen höheren und längeren Unterhaltungswert als Plastikartige Gebrauchsmusik, die lediglich dem Zeitgeist huldigt. Warum es eine solche Masse an uninspirierter Gebrauchsmusik gibt, hängt nicht unwesentlich mit dem Medium zusammen, mit dem diese Musik vorzugsweise konsumiert wird.
Halte dich kurz!
Aktuell im Fokus stehen diverse Streaming Dienste, die allein durch ihre Struktur längere, aufwändig produzierten Titel benachteiligen. Einfach gesprochen: Längere Titel „lohnen“ sich finanziell nicht! Der Mehraufwand wird bei Streaming Portalen schlichtweg nicht vergütet. Ein Beispiel: Damit es zu einer Ausschüttung bei der Plattform Spotify kommt, muss ein Titel gerade einmal dreißig Sekunden am Stück durchgehört werden. Damit wird der Titel monetarisiert. Bedeutet, erst ab einer Laufzeit von 30 Sekunden gibt es Geld für den Künstler. Ist der Song sieben Minuten lang, gibt es keine Extra Vergütung. Das findet nicht nur die Band „The Pocket Gods“ ungerecht. Diese Band konterkariert diese unsägliche Struktur mit einer äußerst unkonventionellen Idee. Das letzte Album der Band umfasst gleich eintausend Songs, alle in einer Länge von dreißig bis sechsunddreißig Sekunden.
Lies den folgenden Artikel darüber: zum Artikel
Das ist auf der einen Seite zwar clever und kreativ, zeigt aber auch deutlich das derzeitige Dilemma des Streaming Mediums. Samsung veröffentlichte unlängst eine interessante Studie. Demnach ist die Aufmerksamkeitsspanne seit dem Jahre 2000 von zwölf auf acht Sekunden gesunken. Demnach entscheidet sich in den ersten acht Sekunden, ob ein Song ein Hit wird oder nicht.
Nicht vergessen:
Wird er innerhalb der ersten 30 Sekunden weggedrückt, gibt es keine Streaming Erlöse für den Künstler. Das hat direkten Einfluss auf die aktuelle „Gebrauchsmusik“ und deren Komposition. Songs verfügen heute oft nicht Mals mehr über ein Intro, sondern starten direkt mit dem Refrain. Bei dem AOR Klassiker “Don’t Stop Believin“ von Journey muss der Rezipient eine Minute und sieben Sekunden lang warten, bis der Refrain zum ersten Mal einsetzt. Nach heutigen Standards eine unglaublich lange Zeitspanne.
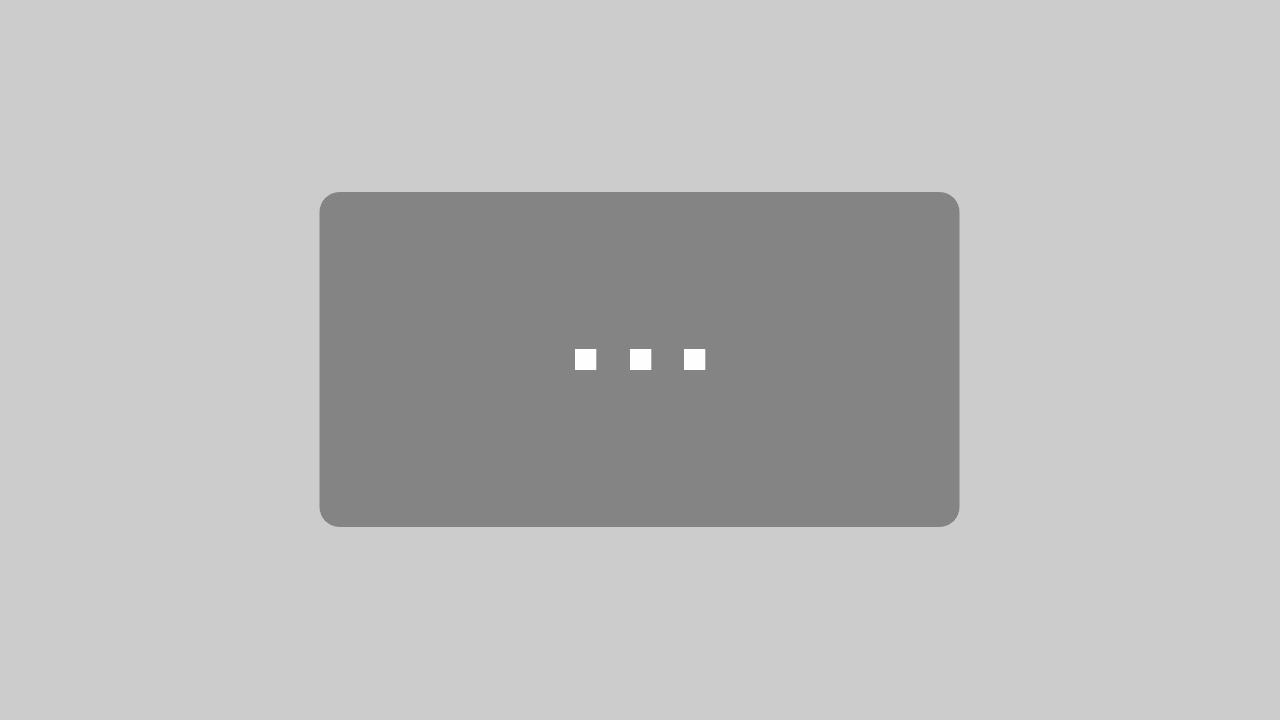
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zudem ist der Song mit 4:10 Minuten für einen Hit ungewöhnlich lang.
Fakt ist: Die Durchschnittslänge sinkt, aufwändige Bridge-Teile oder langwierige Ausbrüche aus bekannten Song Strukturen findet man immer seltener. Eine weitere Prognose besagt, dass Ende des Jahrzehnts die durchschnittliche Songlänge zwei Minuten betragen wird. Das alles lässt nicht zwingend Rückschlüsse auf die tatsächliche Qualität der Musik zu. Festhalten lässt sich aber, dass das kreative Spielfeld für Musiker und Komponisten durch die bestehenden Strukturen und Entwicklungen stark eingeengt wird und der Anreiz, qualitativ hochwertige Musik zu veröffentlichen zunehmend geringer wird.
Die Relevanz des Mediums
Die aktuelle „Skipping Culture“ ist im Grunde ein digitales Phänomen, dass bei Streaming Diensten mit ihren Playlisten und Gapless Playback Abspielmechanismen einen oberflächlichen Konsum begünstigen. Klassische Medien wie Tonband oder Schallplatte bieten einen deutlich anderen Zugang. Das beginnt schon mit der Auswahl eines Tracks. Beim Tonband muss man gezielt zu einem Song hin spulen, bei einer Platte ist der bewusste Griff zum Cover-Karton und das Ansetzen der Nadel ein bewusster Akt.
Diese Handlung beinhaltet nach der Ansicht der Wissenschaft eine Vorkonditionierung. Man lässt sich bereits auf das Hörereignis ein, bevor man den Song überhaupt abspielt. Vielleicht ist das auch ein Baustein, um Musik wieder bewusster wahrzunehmen und vor allem zielgerichtet zu Konsumieren. Das Medium hat einen Einfluss auf den Konsumenten. Was vielen Musikliebhabern vielleicht nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass das Aufnahme- und Abspielmedium selbst einen großen Einfluss auf die Art der Komposition, die Wahl der Musiker, deren Virtuosität und die Länge und Komplexität von Musikstücken hat. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns die Geschichte der Tonaufzeichnungen an.
Die Geschichte der Tonaufzeichnungen
Bevor es die Möglichkeit einer Tonaufzeichnung gab, wurde Musik ausschließ live vorgetragen. Das bedeutet, der Musiker musste sein Handwerk und sein Instrument beherrschen, um seinen Beruf ausüben zu können. Das ist auch in den Anfangszeiten der Aufnahmetechnik weiterhin der Fall gewesen. Aufnahmen fanden als One-Take statt, diesen Druck hielten nur professionelle Musiker stand. In den Anfangstagen der Schallplatte wurde die Aufzeichnung direkt auf das Medium geritzt.
Dabei waren die ersten Aufnahme Gerätschaften ausschließlich akustisch-mechanischer Natur und kamen völlig ohne Elektrizität aus. Wie das ganze funktionierte? Der Schall wird über einen Trichter eingefangen, die Schwingungen über eine Membran umgewandelt und auf einer Platte oder Walze festgehalten. Die einzig zur Verfügung stehende Energie war die Schallenergie selbst. Diese war dafür zuständig, die Information in den Trägermedium zu transformieren. Mikrofone gab es in den Anfangszeiten der Tontechnik nicht, daher mussten Bands und Ensembles recht unnatürlich vor den Aufnahmetrichtern platziert werden. Laute Instrumente wie Bläser standen weiter entfernt, während Streicher und Sänger sich näher vor dem Trichter aufbauten. Bei Spielfehlern musste alles neu aufgenommen werden. Völlig klar, dass dies alles einen Einfluss auf die Art der Musik und deren Spielweise hatte.
Die Pioniere


Die Möglichkeit Sprache oder Musik aufzeichnen zu können, ist noch vergleichsweise jung. Der Franzose Édouard-Léon Scott de Martinville erfand 1857 den „Phonautographen“, ein Gerät zur Aufzeichnung von Schall.
Erst 1877 entwickelte Thomas A. Edison seinen „Phonographen“, der eigentlich für das Diktieren von Nachrichten im Büroalltag konzipiert wurde. Der Vorteil des Phonographen: Das Gerät konnte Töne nicht nur aufnehmen, sondern auch wiedergeben.
Ab 1884 wurde Edisons Konzept von Charles Sumner Tainter und Chichester Alexander Bell weiterentwickelt. Sie nannten ihr Aufnahmegerät „Graphophone“ und erhielten dafür am 4. Mai 1886 ein erstes Patent.

Als Erfinder des bekannten „Grammophons“ gilt allerdings Emil Berliner. Berliner stellte im Mai 1888 sein Grammophon der Öffentlichkeit vor, was gleichzeitig als Geburtsstunde der Schallplatte gilt. Bis in die 1940er Jahre galt Schellack als das Material für Schallplatten bis es Ende der 1940er Jahre endgültig vom PVC (Vinyl) abgelöst wurde.
Mit der Einführung der elektrischen Tonaufzeichnung Mitte der 1920er Jahre überwand man die Grenzen der früheren akustisch-mechanischen Tonaufzeichnung. Die Umwandlung der akustischen Schwingungen in modulierten Strom erzeugte im Schallplatten Schneidegerät elektromagnetisch eine mechanische Kraft, die den Schall völlig unabhängig von seiner Energie im Trägermaterial einritzen konnte. Die ersten elektrischen Tonaufzeichnungen wurden mit einem Mikrofon durchgeführt und waren demnach stets mono.
Georg Neumann entwickelte Ende der 1920er Jahre das Kondensatormikrofon. Mit diesem Mikrofontyp verbesserte sich die Klangqualität dramatisch. Neumann Mikrofone zählen heute noch zum professionellem Studio Standard. Nachdem sich bei den Plattenspielern die Umdrehungsgeschwindigkeit von 78 U/Min auf 33 U/Min änderte und Vinyl statt Schellack als Trägermedium zum Einsatz kann, verbesserte sich die Klangqualität und die Laufzeit des Mediums gleichermaßen. Die erste Stereo-Schallplatte wurde 1957 vorgestellt und Stereophonie galt alsbald als Standard.

On Tape
Zeitgleich zu den Plattenspielern wurde in Deutschland auch an Tonband Geräten gearbeitet. Das Tonband ließ sich Fritz Pfleumer 1928 in Dresden patentieren. Wenige Jahre später verkaufte er das Patent an AEG „Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft“ wo Eduard Schülle das erste Tonbandgerät entwickelte. 1935 entwickelte der Vorläufer des Chemie Unternehmen BASF das Magnettonband.
Das Tonband als Trägermedium hat die Aufnahme- und die Radioindustrie revolutioniert. Erstmals war es möglich Aufnahmen in hoher Qualität auch „off the grid“ also in einer Nicht-Studio Umgebung aufzuzeichnen (z.B. Live-Events). Darüber hinaus bot das Tonband den unschätzbaren Vorteil, dass man es schneiden konnte.
Die erste Stufe von Editierung war damit erreicht. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass ab Ende der 1940er Jahre sich das Tonband weltweit als Aufnahmemedium durchgesetzt hat. Die nächste Evolutionsstufe stellten Mehrspur -Tonbandmaschinen dar. Multitracking ermöglichte es erstmals Overdubs anzufertigen und änderte damit auch nachhaltig die Art, wie Musik aufgenommen wurde. Die Musiker mussten nicht mehr zeitgleich im Kollektiv den Song performen. Ab diesem Zeitpunkt waren auch dezentrale Produktionsabläufe möglich.
Digitale Revolution und seltsame Frisuren
In den 80er Jahren fand die erste digitale Revolution in der Musikproduktion mit dem Einzug der Digitaltechnik statt. Das betraf gleichermaßen das Aufnahmemedium als auch die Instrumente und Klangquellen. Der Fairlight CMI (Computer Musical Instrument) gilt dabei als eines der wichtigsten Werkzeuge. Der Fairlight war der erste digitaler Synthesizer mit Sampling-Technik. Die ersten Exemplare kamen 1979 auf den Markt und unter den ersten Kunden waren Künstler wie Peter Gabriel und Stevie Wonder.
Der Fairlight war aufgrund seiner Preisstruktur nur wenigen Musikern vorenthalten. Im Laufe der Zeit hielten aber vermehrt preisgünstigere Synthesizer, Sequenzer und Drum Machines in den Studios Einzug. Mit der Midi-Schnittstelle wurde zudem ein erstes universelles Kommunikationsprotokoll vorgestellt. Zusammen mit dem mittlerweile üblichen Mehrspur-Recording hatten die neuen Gerätschaften einen massiven Einfluss auf die Musik und die Art wie komponiert und aufgenommen wurde. Der Musiker geriet in den Hintergrund, vor allem Schlagzeuger sahen sich einer digitalen Konkurrenz ausgesetzt. Beats wurden nicht mehr gespielt, sondern programmiert. Die 80er waren auch das Jahrzehnt, indem die CD als digitaler Tonträger die klanglich unterlegene Kompakt Kassette als Standard ablöste.

Die 90er
Die digitale Entwicklung blieb auch in den 90er Jahren nicht stehen. ROMpler stellten Sample Sounds der gebräuchlichsten Instrumente (Streicher, Bläser usw.) in mehr oder weniger guter Qualität für ein überschaubares Investment zur Verfügung. Damit standen sie in direkter Konkurrenz mit echten Musikern. Die Qualität der Sounds verbesserte sich zunehmend in den 90er Jahren, während die ersten DAWs nach und nach die analogen Multitrack Bandmaschine ersetzten. Durch die DAW boten sich auch deutlich mehr Möglichkeiten, aufgenommene Tracks nachträglich zu bearbeiten. Mit diesen neuen technischen Möglichkeiten entstanden auch neuen Musikstile (Techno, Hip-Hop, House), welche die neuen Möglichkeiten geschickt zu nutzen wussten.

Im Jahr 2000
Spätestens seit den 2000er Jahren ist die DAW das Zentrum der Musikproduktion. Die klassische Kombi aus „Mischpult & Bandmaschine“ hatte ausgedient. Zeitgleich gab es mit Napster die erste „Peer to Peer“ Musiktauschbörse, die das Versenden komprimierter Audiodateien im MP3 Format über das Internet ermöglichte. Was 1999 begann, führte dazu, dass die CD als beliebtestes Digital Medium abgelöst wurde. VSTi (virtuelle Instrumente) schränkten die Notwendigkeit für reale Musiker noch weiter ein. Eine Entwicklung, die im Grunde bis dato anhält. Der Status Quo lautet, dass man im Grunde jedes Instrument digitaler Form darstellen kann. Lieder klingen viele Produktionen verblüffend ähnlich, da zum Teil die gleichen Samples und Sounds zum Einsatz kommen.
Zukunft – Back to the Future!
Derzeit ist die Musikproduktion das genaue Gegenteil von dem, wie es in den Anfangstagen war. Damals versammelten sich Musiker und ganze Orchester vor einem Schalltrichter oder einem einzelnen Mikrofon und spielten live und ohne Overdubs ihre Titel direkt ein. Ein nachträgliches Editieren oder Mastering gab es nicht. Heute sind viele Aufnahmeprozesse automatisiert und der Faktor „Mensch“ steht nicht mehr zwingend im Mittelpunkt. Wir haben vieles von dem verloren, was in den Anfangstagen der Tontechnik gang und gäbe war: Minimaler Technikeinsatz bei gleichzeitig maximalem Einsatz der Musiker durch ihr Zusammenspiel. Ist die Rückbesinnung auf die alten Tage vielleicht ein Weg zu mehr Qualität in der Musik? Brauchen wir überhaupt Qualität in der Musik?
Großes Kino
Vielleicht hilft ein Vergleich zur Filmindustrie, um die Frage zu klären, ob Klangqualität überhaupt relevant ist. Bei Film und TV-Produktionen ist es wichtig, die Dialog Qualität sicherzustellen. Das ist aus mehreren Gründen relevant. Zum einen ist bei Fernsehgeräten die Tonwiedergabe nicht normiert. Außerdem bietet der gemeine Flachbildfernseher kaum genügend Platz, um vernünftig dimensionierte Treiber zu verbauen. Sprich: Fernsehton ist oftmals problematisch. Auf den Filmsets wird ebenfalls nicht immer auf maximale Klangqualität Wert gelegt. Daher kann man manche Dialoge schlecht verstehen, was den Genuss eines Films trübt. Die Qualität des Filmtons ist allerdings wichtig für das Gesamterlebnis.
Das gilt auch für Radiosendungen. Hier wird schon aus Gründen der FM-Reichweiten Beschränkung ein maximal verständliches, klares Signal gesendet. Dadurch soll der Hörer so lange wie möglich am Sender bleiben. Mit dem Orban Optimod 8000 wurde 1975 erstmals ein Prozessor für FM-Radiostationen vorgestellt, der einen konstant guten Klang garantieren soll. Bis heute arbeiten die mittlerweile voll digitalen Optimods in den Radiostationen. Optimods beinhalten im Regelfall zumindest einen Kompressor, Equalizer, Enhancer, AGC (Automatic Gain Control) und einen Multiband-Limiter. Im Grunde eine automatisierte Mastering Chain.
FM Mastering
Den Ansatz, dass ein Musikstück auf verschiedensten Anlagen und Wiedergabe Systemen möglichst gut klingen sollte, kennen wir vom Mastering. Ein Mastering, das ausschließlich auf Hi-Fi-Anlagen ausgerichtet ist, funktioniert bei der heutigen Bandbreite an Wiedergabe Systemen allerdings nicht mehr. Daher sollte ein idealer Song neben einer möglichst guten Klangqualität auch mit einer interessanten Komposition und mit lebendigen Einzelspuren überzeugen, was in der Kombination einen originären Titel ergibt.
Die Lebendigkeit und Tiefe lässt sich organisch mit Hilfe von echten Instrumenten und Musiker erzeugen. Das bietet dem menschlichen Gehör mehr Tiefe, mehr Reize als durchautomatisierte Musik. Auch programmierte Songs können diese Tiefe erreichen, dafür müssen diese Songs mit der gleichen Tiefe und Detailverliebtheit programmiert werden, wie sie ein Kollektiv von Musikern einspielen würde. Fertigen Klangbausteinen Leben einzuhauchen ist nicht weniger schwierig, wie ein Instrument virtuos zu beherrschen. Daher lassen es viele Standard Popsong schlichtweg an Finesse vermissen.
Wo ist der Ausweg?
Ein Patentrezept für die Produktion von qualitativ hochwertiger Musik gibt es nicht. Aber verschiedene Ansätze, die den Weg ebnen können. Ein Vorschlag ist, das beste aus allen Welten zu kombinieren! Die aktuelle digitale Aufnahmetechnik bietet so viele Vorteile und Möglichkeiten in Punkto Speicherung und Klangmanipulation im Vergleich zum altbekannten Duo „Bandmaschine & Analogmixer“, so dass man diese neuen Möglichkeiten vollends nutzen und ausreizen sollte.
Die visuelle Editierbarkeit des Arrangements und der Audio-Wellenformen bieten zusätzlich kreatives Potenzial, das genutzt werden will. Dieses Potenzial maximiert sich, wenn man vor einem professionellem Frontend aus guten Mikrofonen und Vorverstärkern veritable Musiker ihren Job machen lässt. Die Kunst wird vor dem Mikrofon gemacht und diese Magie gilt es entsprechend einzufangen. Gerade im Kollektiv mit mehreren Musikern können spontan interessante Ideen entstehen.
Das ist spannender als das durch-skippen unzähliger Sample-Bibliotheken auf der Suche nach dem individuellen Sound. Dabei kommt gerade in den letzten Jahren Bewegung in diese Prozesse. Dem Zeitgeist entspricht es jedenfalls, dass anstatt VST-Instrumente wieder vermehrt auf analoge Synthesizer und Drum Machines zurückgegriffen wird. Analoge Synthesizer erleben in diesen Tagen ein großes Revival.
Spannend an dieser neuen, alten Hardware ist der direkte Zugriff auf die Sound-Struktur und die damit einhergehende Haptik.
Musik zum Anfassen. Dabei stellt diese analoge Hardware im Vergleich zu VSTi oder anderen Instrumenten Plugins natürlich ein größeres Investment dar. Hier schließt sich der Kreis zum Anfang dieses Artikels. Mehr Qualität bedingt fast immer einen höheren Kostenapparat. Am Ende wird man fast immer durch ein besseres Produkt (Song) belohnt.
Mit etwas Glück macht sich dieser Song zudem durch seine Langlebigkeit doppelt bezahlt. Den Fokus von der digitalen Domäne zur analogen Klangerzeugung und Aufnahmetechnik zu wenden und dabei auf den kreativen Input echter Musiker zu setzen, vereint das Beste aus beiden Welten. Das schafft eine Musik, die dem Zuhörer etwas Individuelles und Aufregendes vermittelt. Das notwendige Investment sollte daher gleichermaßen sowohl in tontechnische als auch in musikalische Assets (Vermögenswerte) fließen. In dieser Kombination entsteht Musik, welche auch in vielen Jahren noch Relevanz besitzt. Und Relevanz ist in diesem Fall mit hoher Qualität gleichzusetzen.
Wenn dir der Blog-Beitrag gefällt würde ich mich freuen wenn du den Beitrag auf Social Media teilst.
Vielen Dank fürs Lesen
Euer, Ruben Tilgner